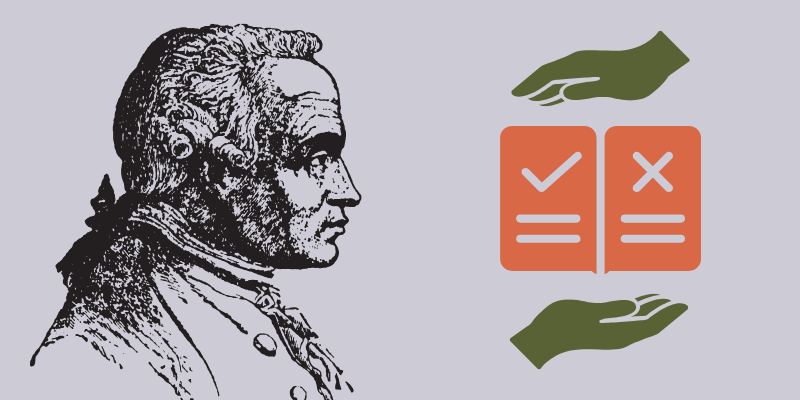Immanuel Kant prägt durch die deontologische Ethik (auch bekannt als Pflichtenethik) bis heute moralische Diskussionen – und den ersten Artikel unseres Grundgesetzes. Im Zentrum seiner Theorie steht der gute Wille: unser Handeln gilt eben dann als gut, wenn wir einer vernünftigen, allgemeinen Pflicht nachkommen. Doch welche Pflichten gelten als gut? Der Beitrag soll eben hierauf eine Antwort liefern und beleuchtet dabei Kants zentrale Konzepte und Begriffe seiner Moralphilosophie.
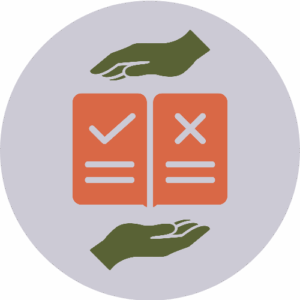
Kant – Deontologische Ethik: Grundlagen
Grundsätzlich gilt eine moralische Handlung bei Kant als gut, wenn ihre Maxime (der Grundsatz einer Handlung) für alle Menschen verallgemeinert werden kann. Beispiel: Das Teilen der eigenen Mitschriften mit einer Freundin ist gut, da man sich hilfsbereit verhält. Hilfsbereitschaft ist eine Maxime, die wir für alle Menschen (sinnvoll) verallgemeinern können.
Für dieses Prinzip formuliert Kant seinen kategorischen Imperativ: Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie zum allgemeinen Gesetz werde. Einfach gesagt: wir sollen nach Grundsätzen handeln, die wir ohne Bedenken für alle Menschen verallgemeinern können. Beispiele hierfür können sein:
- Menschen sollen nicht töten.
- Wir sollen stets ehrlich zueinander sein.
- In einer Gemeinschaft sollte man sich gegenseitig helfen.
- Tiere sollen wir ebenfalls mit Respekt behandeln.
- …
Der gute Wille nach Kant
Für Kant zählen nicht die Folgen einer Handlung, sondern allein die Motive sind bei der Bewertung relevant. Entscheidend hierfür ist für Kant der gute Wille: dieser gilt als gut, wenn er durch eine Pflicht bestimmt wird, die dem kategorischen Imperativ entspricht. „Der gute Wille ist nicht durch das, was er bewirkt oder ausrichtet, nicht durch seine Tauglichkeit zur Erreichung irgend eines vorgesetzten Zweckes, sondern allein durch sein Wollen, d.i. an sich gut […]“.
Das Handeln aus Neigung hingegen würde Kant nicht als gut ansehen. Dies kann ein Beispiel einfach veranschaulichen:
Sarah hilft ihrer Schulfreundin Johanna, indem sie ihr die Aufzeichnungen der letzten Stunde gibt, in der Johanna krank war. Lucas fragt sie ebenfalls nach den Aufzeichnungen, Sarah möchte ihm aber nicht helfen, da er häufig den Unterricht stört.
Sarah handelt in diesem Fall aus Neigung, nämlich in Sympathie zu ihrer Freundin. Kant würde verlangen, aus Pflicht (nämlich der Pflicht zur Hilfsbereitschaft) auch Lucas mit den Aufzeichnungen zu helfen.
Das moralische Gesetz
Die meisten Moraltheorien verfolgen die Vorstellung eines objektiven Prinzips oder allgemein gültigen Regeln, mit denen wir Handlungen als gut und böse einteilen können. Kant nennt dieses Prinzip das „Gebot (der Vernunft) und die Formel des Gebots heißt Imperativ„. Diese werden durch ein Sollen ausgedrückt und bringen den zugrundeliegenden guten Willen zum Ausdruck.
Der Unterschied zwischen dem hypothetischen und kategorischen Imperativ
Imperative können in a) hypothetisch und b) kategorisch unterteilt werden. Als moralisch wünschenswert gilt für Kant der kategorische Imperativ, da er die Beachtung einer Pflicht zum Ausdruck bringt.
a) Hypothetischer Imperativ: Bringt eine Handlung als Mittel zum Zweck zum Ausdruck. (z.B. Ich bin freundlich zu meiner Lehrkraft, um eine gute Note zu erhalten.)
b) Kategorischer Imperativ: Bringt eine Handlung zum Ausdruck, die als objektiv notwendig erscheint und für sich selbst steht. (Ich bin freundlich gegenüber meinen Mitmenschen.)
Kant: Deontologische Ethik – die Bedeutung der Pflicht
Kant unterscheidet in seiner Theorie scharf zwischen Handlungsmotiven (Maximen), die aus Neigung und aus Pflicht entstehen. Er verurteilt das Handeln aus Neigung (z.B. aus Sympathie, aus aktuellen Gefühlslagen etc.) und ist – gewissermaßen – ein Prinzipienreiter. Den moralischen Wert einer Handlung bemisst er daher anhand der zugrundeliegenden Pflicht (oder dem Prinzip des Wollens): „Eine Handlung aus Pflicht hat ihren moralischen Wert nicht in der Absicht, welche dadurch erreicht werden soll, sondern in der Maxime, nach der sie beschlossen wird […]“.
Die Pflicht ist für Kant „die Notwendigkeit einer Handlung aus Achtung fürs Gesetz“. Mit Gesetzen meint er an dieser Stelle Gebote in der Form des kategorischen Imperativs. Sollte man aus reiner Neigung heraus nur „zufällig“ den Gesetzen entsprechen, wäre diese Handlung nicht moralisch gut.
Literaturverzeichnis
Kant, Immanuel: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, hsrg. von Theodor Valentiner, Stuttgart 1984.